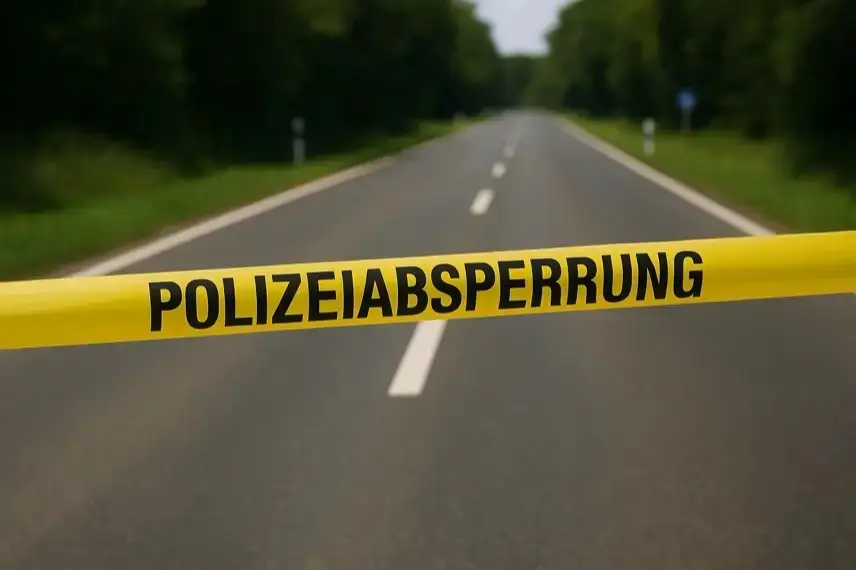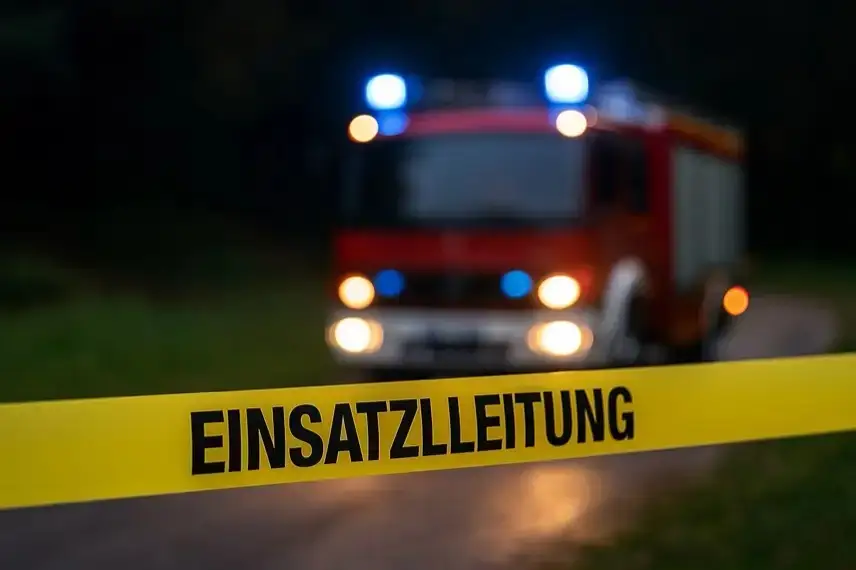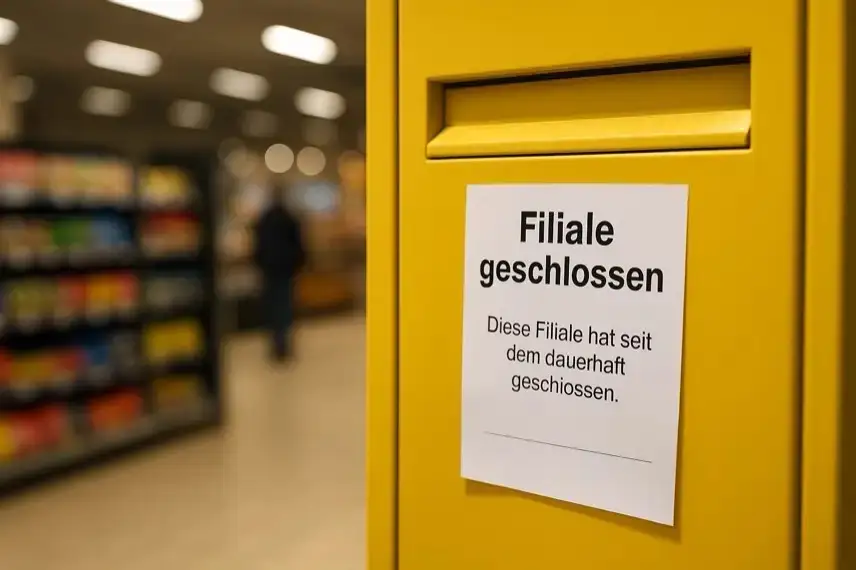Goslar – Der Verfall des Taubenturms im Ulrichschen Garten sorgt zunehmend für Unmut in der Bevölkerung. Während das historische Bauwerk zusehends verfällt, fordern engagierte Bürger und die Bürgerliste im Stadtrat ein klares Sanierungskonzept – und das möglichst sofort.
Ein Denkmal im Dornröschenschlaf
Mitten im Ulrichschen Garten, einem kleinen, beschaulichen Park in der östlichen Altstadt Goslars, steht er: der Taubenturm. Errichtet im späten 18. Jahrhundert, einst versetzt und restauriert, steht er heute für mehr als nur die historische Vergangenheit der Stadt – er steht auch für aktuelle Herausforderungen im Umgang mit dem kulturellen Erbe. Der kleine Turm, der früher Tauben beherbergte, zeigt deutliche Bauschäden, insbesondere an den umliegenden Sandsteinsäulen und dem Fundamentbereich.
„Warum verfällt der Taubenturm im Ulrichschen Garten in Goslar?“, fragen sich mittlerweile viele Bürger. Die Antwort darauf ist ernüchternd: Es fehlt bisher an konkreten Maßnahmen, einer Priorisierung durch die Verwaltung – und letztlich auch an öffentlichem Druck. Zwar liegt dem Stadtrat nun ein Antrag der Bürgerliste vor, der ein umfassendes Sanierungskonzept mitsamt Zeitplan einfordert, doch Ergebnisse lassen auf sich warten.
Initiativen aus der Bevölkerung: Engagement statt Resignation
Als Reaktion auf die anhaltende Untätigkeit startete die „Initiativgruppe Altstadt“ eine Online-Petition unter dem Titel „Warum verfällt der Taubenturm…“, mit dem Ziel, die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung zum Handeln zu bewegen. Unterstützt wird die Petition von der Bürgerliste, die sich seit Jahren für den Erhalt historischer Bausubstanz in Goslar starkmacht.
Auch offline wächst das Engagement. Beim dritten Nachbarschaftsfest im Ulrichschen Garten informierte ein eigens eingerichteter Petitionsstand über die Problematik und sammelte Unterschriften. „Ohne öffentlichen Druck scheint in Goslar nichts voranzukommen“, äußerte sich ein Anwohner auf der Plattform. Die Atmosphäre bei der Aktion: familiär, aber bestimmt. Der Wunsch nach Veränderung ist deutlich spürbar.
Der politische Druck steigt
Die Bürgerliste bringt mit ihrem Antrag frischen Wind in die Debatte. In dem Ratsantrag wird das Goslarer Gebäudemanagement (GGM) aufgefordert, ein konkretes Sanierungskonzept samt Zeitplan und Finanzierung aufzustellen. Die Finanzierung solle aus Mitteln des Sanierungsgebiets „östliche Altstadt“ erfolgen – ein Gebiet, das ohnehin für strukturelle Verbesserungen vorgesehen ist.
Doch das Engagement geht noch weiter: Die Bürgerliste verlangt eine frühzeitige Einbindung des Fledermausbeauftragten sowie der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Der Grund dafür liegt in der besonderen ökologischen Bedeutung des Taubenturms. Er dient als Sommerquartier für verschiedene Fledermausarten – ein sensibler Lebensraum, der laut Artenschutzgesetz besonders geschützt werden muss.
Welche Rolle spielt der Fledermausschutz beim Taubenturm in Goslar?
Die biologische Vielfalt in urbanen Räumen wird oft unterschätzt. Im Fall des Taubenturms ist bekannt, dass mehrere Fledermausarten das Bauwerk während der warmen Monate als Quartier nutzen. Dadurch ist jede bauliche Veränderung oder Sanierungsmaßnahme automatisch ein artenschutzrechtlich relevantes Vorhaben. Ein unkoordinierter Eingriff könnte zu empfindlichen Störungen führen. Deshalb ist die Beteiligung von Naturschutzakteuren nicht nur wünschenswert, sondern rechtlich geboten.
Sanierung: Zwischen Machbarkeit und politischem Willen
Technisch gesehen ist eine Sanierung des Turms möglich. Eine detaillierte Fotodokumentation, die dem Ratsantrag beiliegt, zeigt die strukturellen Schwachstellen: Risse im Mauerwerk, abbröckelnde Sandsteinsäulen und eine mangelnde Fundamentierung. Dennoch bleibt die Frage: Wie kann man den Taubenturm in Goslar denkmalgerecht sanieren und finanzieren?
Die Antwort liegt in einer Kombination aus kommunalen Mitteln, Förderprogrammen und klarer politischer Priorisierung. Der Status als denkmalgeschütztes Gebäude innerhalb eines UNESCO-Weltkulturerbes eröffnet prinzipiell Fördermöglichkeiten – sowohl vom Bund als auch vom Land. Voraussetzung ist jedoch eine fachgerechte Planung und Genehmigung durch die zuständigen Behörden.
Fördermöglichkeiten und rechtliche Rahmenbedingungen
Welche Fördermöglichkeiten gibt es in Goslar für die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude?
Für Eigentümer und Kommunen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Zuschüsse und Steuervergünstigungen für denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten. In Goslar sind Maßnahmen über das Sanierungsgebiet „östliche Altstadt“ besonders förderfähig. Auch steuerliche Erleichterungen nach den §§ 7 i und 10 f EStG stehen zur Verfügung – sofern die Maßnahmen mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt sind.
Zusätzlich bietet der UNESCO-Status der Stadt die Chance, sich für Förderprogramme wie „Nationale Projekte des Städtebaus“ oder das „Programm zur Erhaltung national wertvoller Kulturgüter“ zu bewerben. Voraussetzung: eine genaue Projektdefinition, transparente Mittelverwendung und breite politische Unterstützung.
Kritik an der Stadtverwaltung: Ein strukturelles Problem?
Die Kritik an der Verwaltung ist nicht neu. Schon in früheren Jahren hatte die Bürgerliste bemängelt, dass das Weltkulturerbe Goslars zunehmend durch Vernachlässigung gefährdet sei. So wurden etwa Abrisse im Kaiserpfalzquartier ohne vorherige Einbindung von Naturschutzbehörden durchgeführt – ein Fehler, der beim Taubenturm nicht wiederholt werden soll.
Henning Wehrmann, Ratsherr der Bürgerliste, kritisiert: „Den Bürgern wird Sand in die Augen gestreut. Der bauliche Verfall wird heruntergespielt, die Verantwortung weggeschoben.“ Weitere Beispiele wie das leerstehende Hotel Brusttuch, die ehemalige Ratsapotheke oder das marode historische Pflaster würden laut Wehrmann zeigen, dass die Stadt ihrer Vorbildfunktion im Umgang mit dem Welterbe nicht gerecht werde.
Regionale Einordnung: Taubentürme als Kulturerbe
Der Goslarer Taubenturm ist kein Einzelfall. In der Harzregion finden sich weitere vergleichbare Bauten – etwa in Quedlinburg oder Osterwieck. Dort sind Taubentürme nicht nur als architektonische Zeugen vergangener Zeiten erhalten, sondern werden auch kulturell genutzt. In Osterwieck wurde ein Taubenturm zum Beispiel als Kulisse für Filmproduktionen eingesetzt. Das zeigt: Denkmalpflege und kulturelle Nutzung schließen sich nicht aus – sie können sich sogar bereichern.
Stimmen aus der Bevölkerung: Mehr als nur Nostalgie
Auf der Plattform der Petition äußern sich zahlreiche Bürger direkt. Sie alle zeigen eine Mischung aus Frust, Hoffnung und Engagement:
- „Dieser Ort der Ruhe in der Altstadt muss unbedingt erhalten werden.“
- „Um die Stadtverwaltung an ihre Pflichten zu erinnern.“
- „Der Turm ist ein Teil meiner Kindheit, ich will nicht zusehen, wie er verfällt.“
Diese Stimmen verleihen der Diskussion eine emotionale Komponente. Es geht nicht nur um Steine, Mörtel und Fördergelder – es geht auch um Heimat, Identität und Verantwortung.
Ein Ort mit Geschichte – und Zukunft?
Die Debatte um den Taubenturm hat inzwischen eine symbolische Bedeutung weit über das kleine Bauwerk hinaus gewonnen. Sie steht exemplarisch für die Frage, wie Städte mit ihrem historischen Erbe umgehen – zwischen finanziellen Zwängen, ökologischen Anforderungen und bürgerschaftlichem Engagement.
Ob der Turm erhalten bleibt, wird nicht nur von der Verwaltung entschieden, sondern auch vom Druck und der Aufmerksamkeit, die durch Aktionen wie die Petition, das Nachbarschaftsfest und die Anträge im Rat entstehen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit – und gleichzeitig eine Gelegenheit, zu zeigen, dass Geschichte nicht im Museum verstauben muss, sondern Teil lebendiger Stadtentwicklung ist.
Goslar hat bereits bewiesen, dass es historische Gebäude sanieren und neu beleben kann – vom Rathaus über das Mönchehaus bis zur Stadtmauer. Vielleicht wird auch der Taubenturm bald wieder das sein, was er einmal war: ein stolzes, kleines Wahrzeichen mitten in einer Stadt mit großem Erbe.