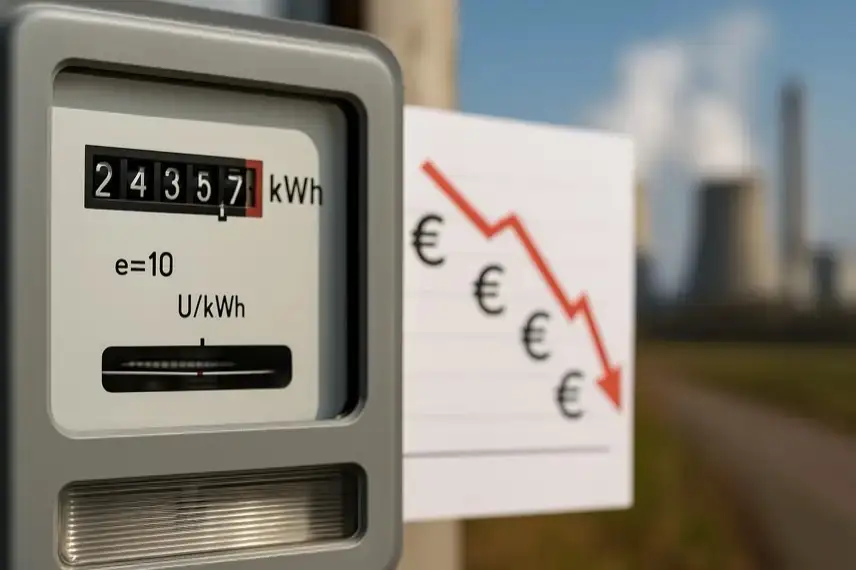Halberstadt/Harz – In der Region um Halberstadt schwelt ein Konflikt um geplante Windkraftanlagen, noch bevor ein verbindlicher Zeitplan vorliegt. Politische Entscheidungen hinter verschlossenen Türen, Sorgen um Naturschutz und unterschiedliche Interessenlagen zwischen Kommunen, Investoren und Bürgern sorgen für Unruhe. Gleichzeitig schreitet die Regionalplanung voran, während das Land ehrgeizige Ausbauziele verfolgt.
Frühe Debatten ohne festen Fahrplan
Offiziell gibt es noch keinen konkreten Terminplan für den Ausbau der Windenergie in der Region Halberstadt. Dennoch wird das Thema bereits kontrovers diskutiert. Auslöser sind unter anderem nichtöffentliche Beratungen im Ortschaftsrat Ströbeck, bei denen ein Tagesordnungspunkt zum „Abschluss eines Nutzungsvertrags“ behandelt wurde. Zwar liegen die genauen Inhalte dieser Beratungen nicht öffentlich vor, doch die Verbindung zu potenziellen Windkraftflächen nördlich von Ströbeck wird vielfach hergestellt – und genau das sorgt für Spannungen.
Ein wichtiger Punkt ist die laufende Arbeit der Regionalen Planungsgemeinschaft Harz (RPG Harz) am sogenannten „Sachlichen Teilplan – Wind“. Dieser soll im Jahr 2025 in einem zweiten Entwurf vorgestellt und breit öffentlich diskutiert werden. Erst danach werden Vorrangflächen verbindlich festgelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind alle Standortangaben vorläufig und ohne Genehmigungswirkung.
Warum es schon Streit gibt, bevor der Zeitplan steht
Die Frage, „Warum kommt es zum Streit über Windkraftprojekte rund um Halberstadt, obwohl noch kein fixer Zeitplan vorliegt?“, lässt sich mit mehreren Faktoren beantworten. Zum einen fühlen sich Bürgerinnen und Bürger durch nichtöffentliche Beratungen ausgeschlossen. Zum anderen kursieren bereits konkrete Flächenbezeichnungen wie „Schmiedestein (Ost)“ und „Schmiedestein (West)“, die von Bürgerinitiativen wie „Gegenwind Nordharz“ aufgegriffen werden. Diese Initiativen argumentieren insbesondere mit Natur- und Artenschutz und sehen in den möglichen Standorten einen erheblichen Eingriff in Landschaftsbild und Ökosysteme.
Hinzu kommt der hohe Schutzgüteranteil in der Region: Rund 37 Prozent der Fläche sind bewaldet, 56 Prozent liegen in Landschaftsschutzgebieten, 19 Prozent sind Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Diese Rahmenbedingungen erhöhen die Sensibilität für Eingriffe und erschweren die Suche nach geeigneten Vorrangflächen.
Landesweite Ziele und gesetzliche Rahmenbedingungen
Das Land Sachsen-Anhalt hat sich verpflichtet, bis Ende 2027 mindestens 1,8 Prozent und bis Ende 2032 mindestens 2,2 Prozent der Landesfläche für Windenergie bereitzustellen. Dieses Ziel wird maßgeblich über die Regionalplanung umgesetzt. 2024 hat das Land außerdem das pauschale Verbot für Windkraftanlagen im Wald aufgehoben – nun entscheiden die Planungsgemeinschaften im Einzelfall, ob und welche Waldflächen für den Ausbau genutzt werden können.
Im Juni 2025 waren in Sachsen-Anhalt insgesamt 2.759 Windenergieanlagen mit einer Leistung von rund 5.596 Megawatt in Betrieb. Allein im Jahr 2024 wurden 48 neue Anlagen errichtet, die zusätzliche 189 Megawatt Leistung brachten. Die Ausbauziele sind ehrgeizig, und der Harz spielt als potenzieller Standort trotz seiner ökologischen Sensibilität eine strategische Rolle.
Bürgerinitiativen als treibende Kräfte
Bürgerinitiativen wie „Gegenwind Nordharz“ haben sich als zentrale Akteure im Diskurs etabliert. Sie informieren über mögliche Standorte, sammeln Unterschriften für Petitionen und organisieren Informationsveranstaltungen. Eine ihrer Kernargumentationen betrifft den Rotmilan, einen Greifvogel, für den besondere Schutzvorschriften gelten. Die Region gilt als Dichtezentrum dieser Art, was Planer zwingt, umfangreiche Gutachten und Ausgleichsmaßnahmen vorzulegen.
Auch in sozialen Medien sind die Initiativen präsent. In lokalen Facebook-Gruppen werden Stadtratstagesordnungen geteilt, Mitschriften veröffentlicht und Termine für Einwohnerversammlungen angekündigt. Politische Gruppen wie die Freien Wähler Harz greifen die Inhalte dieser Initiativen auf und verstärken sie über ihre eigenen Kanäle. Das Zusammenspiel von lokaler Politik und bürgerschaftlichem Engagement prägt die Debatte nachhaltig.
Kommunale Interessen und finanzielle Beteiligung
Ein weiterer Aspekt sind die finanziellen Chancen für betroffene Kommunen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erlaubt Betreibern von Windkraftanlagen, bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde an die Standortgemeinden zu zahlen. Diese Beteiligung kann spürbare Einnahmen generieren, die für lokale Projekte verwendet werden. Dennoch sind nicht alle Gemeinden automatisch bereit, diese Chance zu nutzen, wenn dafür landschaftliche Veränderungen in Kauf genommen werden müssen.
Halberstadt selbst positioniert sich zunehmend strategisch im Bereich kommunaler Energieversorgung. Im Juni 2025 war die Stadt Gastgeber des „Forum KOMMUNAL“, bei dem unter anderem das Thema dezentrale Energieversorgung im Fokus stand.
Genehmigungsverfahren und Zeitfaktoren
Wer sich fragt, „Wie lange dauert die Genehmigung eines Windenergieprojekts typischerweise in Deutschland?“, sollte wissen: Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Genehmigungsdauer bei rund 23 Monaten. Hinzu kommen Vorlaufzeiten für Standortanalysen, Gutachten und Netzanschlüsse. Verfahren können sich verlängern, wenn Klagen eingereicht oder zusätzliche Prüfungen notwendig werden.
Auch der Netzausbau spielt eine Rolle. Im Jahr 2024 mussten deutschlandweit 22,8 Terawattstunden Strom im Rahmen des Redispatch-Managements angepasst werden, wovon 14,5 Terawattstunden als Reduktionen erfolgten. Rund 9,4 Terawattstunden erneuerbare Erzeugung gingen durch Abregelung verloren. Diese Zahlen zeigen, dass auch die Netzkapazität ein begrenzender Faktor für den schnellen Ausbau sein kann.
Akzeptanz in der Bevölkerung
Laut einer forsa-Umfrage aus dem Herbst 2024 halten 78 Prozent der Bevölkerung in Deutschland den Ausbau der Windenergie an Land für wichtig oder sehr wichtig. Unter Menschen, die bereits in der Nähe von Windkraftanlagen leben, liegt die Zustimmung bei 79 Prozent. 67 Prozent derjenigen, die bisher keine Anlagen in der Umgebung haben, hätten keine oder nur geringe Bedenken, wenn neue gebaut würden. Allerdings wünschen viele eine stärkere Mitsprache der Kommunen und greifbare Vorteile für die Region.
Lokale Besonderheiten und kulturelle Sensibilität
Der Ortsteil Ströbeck ist als „Schachdorf“ bekannt und steht auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Dieses kulturelle Alleinstellungsmerkmal wird in lokalen Debatten oft mitgedacht. Veränderungen im Landschaftsbild durch große Windkraftanlagen werden hier auch unter dem Aspekt der kulturellen Identität betrachtet, was zusätzliche Sensibilität in der Planung erfordert.
Naturschutz und technische Herausforderungen
Die Frage „Welche Bedeutung hat der Rotmilan im Zusammenhang mit Windkraft im Harz?“ wird in der Region häufig gestellt. Der Rotmilan ist streng geschützt, und in bekannten Brutgebieten gelten strenge Abstandsvorgaben. Auch andere Arten wie Fledermäuse müssen berücksichtigt werden, sodass komplexe Artenschutzleitfäden zur Anwendung kommen. Diese Maßnahmen dienen dem Ausgleich zwischen Energiewende und Naturschutz, erhöhen jedoch den Planungsaufwand und können zu zeitlichen Verzögerungen führen.
Technisch gesehen stehen Projektierer vor der Aufgabe, Standorte so zu wählen, dass sie sowohl wirtschaftlich als auch naturschutzrechtlich tragfähig sind. Höhenbegrenzungen, Abstandsvorgaben und Lärmschutz spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Topografie des Harzes.
Erweiterte Flächenoptionen durch Waldregelung
Mit der Gesetzesänderung von 2024 wurde die Möglichkeit geschaffen, auch Waldflächen für Windkraft zu nutzen. Auf die Frage „Könnte die neue Regelung zu Windkraft im Wald das Verfahren im Harz beschleunigen?“ lautet die Antwort: Grundsätzlich ja, weil der Flächenpool dadurch größer wird. In der Praxis hängt es jedoch von der Entscheidung der Regionalplanung, den konkreten Schutzgütern vor Ort und den Ergebnissen der Umweltprüfungen ab, ob diese Flächen tatsächlich erschlossen werden können.
Der weitere Verlauf der Planungen im Raum Halberstadt hängt maßgeblich von der Veröffentlichung des zweiten Entwurfs des Regionalplans 2025 ab. Erst dann wird klar, welche Flächen tatsächlich als Vorranggebiete in Betracht kommen. Anschließend folgen detaillierte Genehmigungsverfahren, Artenschutzgutachten, Bürgerbeteiligungen und eventuell gerichtliche Auseinandersetzungen. All dies macht deutlich: Selbst bei zügiger Bearbeitung ist mit einer mehrjährigen Laufzeit zu rechnen, bevor neue Anlagen tatsächlich ans Netz gehen.
Bis dahin bleibt der Konflikt zwischen den Zielen der Energiewende, den Interessen der Kommunen, den Sorgen der Bürger und den Anforderungen des Naturschutzes ein prägendes Thema für die Region. Der Streit um die Windkraft bei Halberstadt ist damit mehr als nur eine lokale Auseinandersetzung – er steht exemplarisch für die Herausforderungen, vor denen viele Regionen in Deutschland stehen.