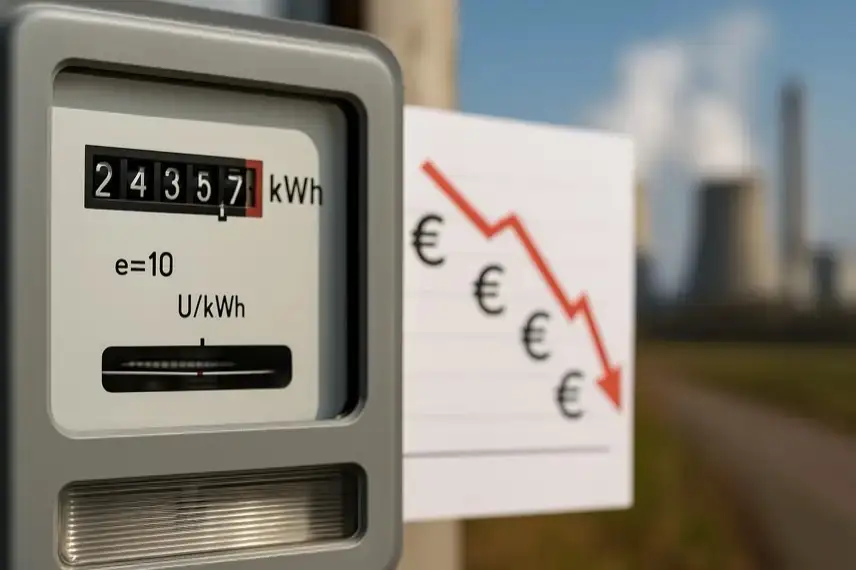Wegeleben (Harz) – Mitten in der Getreideernte geriet am Sonntag eine Strohpresse auf einem Feld zwischen Wegeleben und Deesdorf in Brand. Innerhalb weniger Minuten breiteten sich die Flammen auf das umliegende Stoppelfeld und die Zugmaschine aus. Nur dank des schnellen Eingreifens mehrerer Feuerwehren und der Unterstützung örtlicher Landwirte konnte Schlimmeres verhindert werden.
Der Einsatz am Sonntagmittag
Am 10. August 2025, kurz nach 12:20 Uhr, ging der Notruf bei der Leitstelle ein: Eine landwirtschaftliche Strohpresse stand auf der L24 kurz vor Deesdorf in Flammen. Die Alarmierung erfolgte unter dem Einsatzstichwort „B2“, Einsatznummer 33/2025. Vor Ort bestätigte sich die Lage – die Presse brannte in voller Ausdehnung, das Feuer hatte bereits auf das gepresste Stroh und den angehängten Traktor übergegriffen.
Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wegeleben und Deesdorf rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Zwei C-Rohre wurden sofort vorgenommen, um die Maschine und das brennende Stroh zu löschen. Zeitgleich bekämpften Kameraden aus Deesdorf den Brand auf dem Stoppelfeld. Die Wasserversorgung stellte eine besondere Herausforderung dar, da der Brandort weitab des nächsten Hydranten lag. Hier kamen die ortsansässigen Landwirte ins Spiel: Mit Güllefässern und Wasserfässern brachten sie dringend benötigtes Löschwasser aufs Feld.
Sachschaden in sechsstelliger Höhe
Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 460.000 bis 480.000 Euro. Betroffen sind die völlig zerstörte Strohpresse, die Zugmaschine sowie Teile der Ernte. Auch ein Abschnitt des Stoppelfeldes brannte vollständig ab. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort noch am selben Tag, um die Ermittlungen zur Ursache aufzunehmen.
Unklar bleibt derzeit, ob ein technischer Defekt, menschliches Versagen oder äußere Einflüsse zum Feuer führten. „Bei der Arbeit mit solchen Maschinen kommen mehrere Risikofaktoren zusammen – hohe mechanische Belastung, Hitzeentwicklung und trockene Erntebedingungen“, so ein erfahrener Feuerwehrmann aus der Verbandsgemeinde Vorharz.
Warum fangen Strohpressen so oft Feuer?
Die Frage „Warum fängt eine Strohpresse beim Ernten so häufig Feuer?“ stellen sich nicht nur Betroffene, sondern auch viele Landwirte und Feuerwehrleute. Die Gründe sind vielfältig: Erhitzte Lager, Funken durch Steine oder Metallteile, verölte Maschinenteile und trockener Staub bieten ideale Bedingungen für eine Entzündung. Besonders in Hitzeperioden, wenn das Erntegut extrem trocken ist, genügt oft schon ein kleiner Funke, um ein Feuer auszulösen.
Das Wetter als Brandbeschleuniger
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Zeitraum um den 10. August 2025 eine erhöhte Brandgefahr prognostiziert. Die Tage zuvor waren trocken und sonnig, der Oberboden stark ausgetrocknet. Der Grasland- und Waldbrandgefahrenindex lag in vielen Regionen auf hohen Stufen. Diese Wetterlage begünstigt Brände in der Landwirtschaft erheblich – zumal Stoppelfelder und Erntemaschinen in dieser Zeit besonders beansprucht werden.
Vergleichsfälle in der Region
Der Brand in Wegeleben ist kein Einzelfall. Bereits im Juli kam es bei Abbenrode im Landkreis Harz zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem ebenfalls eine Strohballenpresse in Flammen aufging. Auch dort war die Wasserversorgung problematisch, und die Feuerwehr setzte auf eine sogenannte „Pump-and-Roll“-Taktik – das Löschen während der Fahrt über das Feld. Solche Einsätze zeigen, dass sich bestimmte Probleme in der Erntezeit wiederholen.
Technische Details und Leistungsgrenzen
Eine moderne Rundballenpresse kann bis zu 40 bis 50 Ballen pro Stunde pressen. Diese enorme Arbeitsleistung bringt die Technik an ihre thermischen Grenzen. Hohe Drehzahlen, massive Reibung und die gleichzeitige Belastung durch Staub und Strohpartikel erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Hitzestaus oder Funkenbildung. In Foren wie „Landtreff“ berichten Landwirte regelmäßig von Beinahe-Bränden und geben Tipps zur Prävention.
Präventive Maßnahmen aus der Praxis
- Regelmäßige Reinigung mit Druckluft oder Akku-Laubbläsern
- Mitführen von Feuerlöschern (mindestens 9 Liter)
- Überprüfung von Lagern und beweglichen Teilen vor jedem Arbeitstag
- Einbau von Temperatur-Sensoren, sofern technisch möglich
- Vermeidung von Steinen oder Metallteilen im Erntegut
Kann schon ein kleiner Funke eine Strohpresse komplett in Brand setzen?
Ja – und genau das macht solche Brände so gefährlich. In einem Umfeld, in dem extrem trockenes, fein zerkleinertes Material verarbeitet wird, genügt ein Funke, um einen Mottbrand auszulösen. Dieser kann sich innerhalb weniger Sekunden zu einem Vollbrand entwickeln, da das Stroh wie ein Zunder wirkt. Beispiele aus den letzten Jahren bestätigen, dass Funkenbildung durch Metallabrieb oder Steinkontakt eine der Hauptursachen ist.
Herausforderungen für die Feuerwehr
Bei Feldbränden ohne direkte Wasserversorgung müssen Einsatzkräfte improvisieren. Tanklöschfahrzeuge pendeln zwischen Wasserentnahmestellen und dem Brandort, um den Löschwasservorrat aufrechtzuerhalten. Auch Güllefässer oder mobile Wassercontainer von Landwirten werden eingebunden. In manchen Fällen kommen Schaummittel zum Einsatz, um die Oberflächenspannung zu brechen und das Eindringen des Wassers ins brennende Material zu erleichtern.
Gibt es technische Maßnahmen, die Strohpressen sicherer machen können?
Hersteller arbeiten an Lösungen wie dem Einbau von Gebläsen zur Entstaubung, Temperatursensoren zur Überwachung von Lagern und dem Einsatz von feuerhemmenden Materialien. Dennoch setzen sich solche Innovationen nur langsam durch, da sie häufig mit zusätzlichen Kosten verbunden sind und bei älteren Maschinen technisch nicht ohne Weiteres nachrüstbar sind.
Die Rolle der Landwirte im Einsatz
Ohne die schnelle Hilfe der Landwirte wäre der Einsatz in Wegeleben womöglich anders verlaufen. Mit Güllefässern und Frontladern halfen sie, das brennende Stroh auseinanderzuziehen und so die Ausbreitung der Flammen zu verhindern. „In solchen Momenten zählt jede Minute. Die Unterstützung der Landwirte ist Gold wert“, erklärte ein Einsatzleiter vor Ort.
Offene Fragen nach dem Brand
Auch Tage nach dem Einsatz sind einige Fragen offen. Neben der endgültigen Schadenshöhe steht vor allem die Ursache im Fokus der Ermittler. Ob ein technischer Defekt, unsachgemäße Handhabung oder äußere Umstände den Brand ausgelöst haben, ist noch unklar. Die Polizei will erst nach Abschluss aller Untersuchungen eine Stellungnahme abgeben.
Lehren aus dem Einsatz
Der Brand in Wegeleben verdeutlicht, wie schnell sich ein alltäglicher Arbeitseinsatz in eine Gefahrensituation verwandeln kann. Präventive Maßnahmen, regelmäßige Wartung und die ständige Aufmerksamkeit während der Arbeit sind entscheidend, um solche Brände zu vermeiden. Zudem zeigt der Vorfall, wie wichtig eingespielte Abläufe zwischen Feuerwehr und Landwirten sind – gerade in ländlichen Regionen, in denen Hydranten weit auseinanderliegen.
Ein Sommer voller Risiken
Die Kombination aus hoher Ernteaktivität, trockenen Witterungsbedingungen und der ständigen Gefahr von Funkenbildung macht die Sommermonate zu einer kritischen Phase für Landwirte und Einsatzkräfte. In den kommenden Wochen ist daher mit erhöhter Aufmerksamkeit und möglicherweise weiteren Einsätzen dieser Art zu rechnen.
Der Einsatz in Wegeleben wird den Beteiligten wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. Nicht nur, weil innerhalb weniger Minuten ein hoher Sachschaden entstand, sondern auch, weil er erneut vor Augen führte, wie wichtig Prävention, Technikpflege und Gemeinschaftssinn sind. Das schnelle Zusammenspiel von Feuerwehr und Landwirten verhinderte eine noch größere Katastrophe. Doch der Brand ist auch ein Appell, die Sicherheitsstandards in der Landwirtschaft weiter zu erhöhen – damit aus einem heißen Arbeitstag nicht binnen Sekunden ein gefährlicher Flammenherd wird.